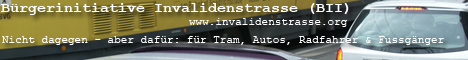- in erster Linie aus dem Trennungsgrundsatz aus § 50 BImSchG,
- in zweiter Linie aus sogenannten aktiven Schallschutzmaßnahmen im Sinne von § 41 Abs. 1 BImSchG und erst in
- dritter Linie aus passiven Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster und Lüftungen) bestehen.
Mit dem Trennungsgrundsatz, der auch im Rahmen der Trassierung einer Straßenbahnstrecke Anwendung zu finden hat, setzt sich der Autor des schalltechnischen Berichts überhaupt nicht auseinander. Dabei scheint es ohne weiteres denkbar, bspw. in den Bereichen vor der Charité und den Wohnhäusern Invalidenstraße 90 und 86, aber auch von den Häusern Invalidenstraße 98-104 die Straßenbahnschienen weiter entfernt von der anliegenden Wohnbebauung zu legen oder andersherum – so denn durch anderweitigen aktiven Lärmschutz eine – zumindest annäherungsweise – Einhaltung der Grenzwerte sichergestellt werden kann, die Straßenbahnschienen näher an die Häuser heran und die Kfz-Fahrbahnen weiter von den Häusern entfernt zu legen.
Der Autor des schalltechnischen Berichts hat weiter nichts dazu ausgeführt, warum er keine aktiven Schutzmaßnahmen erwägt. Nach § 41 Abs. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes müssen solche Maßnahmen jedoch vorrangig ergriffen werden. Danach ist bei dem Bau und der Änderung u.a. von Straßenbahnen sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.
In Übereinstimmung mit Anlage 2 zur 16. BImSchV weist der Verfasser des schalltechnischen Berichts u.a. im unteren Teil der Tabelle 1 (S. 19) darauf hin, dass Gleiskörper mit Raseneindeckung gegenüber Straßenbahngleisen, die in einer Fahrbahn eingebettet sind, einen „Lärmvorteil“ von 7 dB(A) aufweisen.
Der Autor des schalltechnischen Berichts musste bei Durchsicht der Tabellen 3 und 4 erkennen, dass durch den – zumindest weitgehend – durchgängigen Einbau des „Rasengleises“ die Überschreitung der Lärmgrenzwerte der 16. BImSchV weitgehend zu vermeiden wäre.
Er erwägt aber nicht nur den Einbau eines Rasengleises nicht. Er stellt auch keine Voraussetzungen für eine Abwägung mit den eventuell entgegen stehenden Verkehrsinteressen dar. Er leitet noch nicht einmal plausibel ab, warum auf welchen Abschnitten „Rasengleise“ vorgesehen und auf anderen Abschnitten nicht, ob also eine räumliche Ausdehnung der „Rasengleise“ als aktive Schallschutzmaßnahme in Betracht kommt – und damit vorrangig vor den passiven Schallschutz vorgesehen werden muss.
Der Autor des schalltechnischen Berichts verfügt wohl über einen breiten Erfahrungsschatz, der ihn allerdings wohl dazu verführt, Behauptungen ohne jeden Beleg, jede Quelle oder plausible Ableitung aufzustellen.
Dies gilt zunächst für die Behauptung auf S. 6 unten, zwischen der Straße Am Nordbahnhof und Chausseestraße sowie zwischen Gartenstraße und der neuen Gleisverbindung zum Nordbahnhof liege streng genommen kein erheblicher baulicher Eingriff vor. Dort wird die Behauptung aufgestellt, als erheblicher baulicher Eingriff gelte eine Horizontalverschiebung ab 1 m. Eine solche Normierung kennt jedoch weder das Bundesimmissionsschutzgesetz noch die Verkehrslärmschutzverordnung. Der Autor des schalltechnischen Berichts leitet diese Behauptung auch aus keinen sonstigen plausiblen Darlegungen ab, so dass sie nicht nachvollziehbar ist. Im Ergebnis ist dies allerdings unschädlich, da er nachfolgend unter Bewertung aller zu berücksichtigenden Maßnahmen zu dem zutreffenden Ergebnis kommt, dass die Regelungen der 16. BImSchV für den erheblichen baulichen Eingriff für die gesamte Straßenbahnstrecke von Gartenstraße bis Chausseestraße anzuwenden seien.
Auf S. 8 führt er dann aus, von der Sandkrugbrücke bis Lehrter Straße / Clara-Jaschke-Staße sei ein besonderer Bahnkörper vorgesehen. Dies ermögliche den weitgehenden Einsatz eines schallabsorbierenden Rasengleises („Grünes Gleis“). Der Gutachter hätte hier weitergehen müssen und untersuchen müssen, ob in den anderen Bereichen der Einsatz eines Rasengleises geboten ist. Dies ist anhand der nach den Berechnungen ausgewiesenen Grenzwertüberschreitungen ohne weiteres zu bejahen. Er hätte dann weiter untersuchen müssen, ob und ggf. unter welchen Gesichtspunkten davon abgesehen werden darf. Hierzu finden sich aber in den einschlägigen Unterlagen keine Aussagen.
Nicht nachvollziehbar sind auch die Annahmen über die den Berechnungen zugrunde gelegten Zugzahlen und das Zugmaterial.
Hinsichtlich der Zugzahlen ist auf S. 9 „das vorgesehene Betriebsprogramm der BVG (Stand 22. März 2007)“ erwähnt. Eine schalltechnische Berechnung stellt jedoch üblicherweise auf einen bestimmten Prognosehorizont ab. Entsprechend den Ansätzen im Bundesverkehrswegeplan wird derzeit auf einen Prognosehorizont zumindest bis zum Jahr 2015, nach neueren Prognosen im Land Berlin sogar 2025 abgestellt. Das Abstellen auf ein „vorgesehenes Betriebsprogramm der BVG“ stellt nicht sicher, dass diejenige Belastung berechnet wird, die in der Zukunft tatsächlich zu erwarten ist. Der Autor des schalltechnischen Berichts setzt sich mit dem vorgesehenen Betriebsprogramm und mit der Frage, ob innerhalb eines angemessenen Prognosehorizonts mit einer Steigerung des Straßenbahnaufkommens zu rechnen ist, auch nicht auseinander.
Von Seiten der Einwender ist davon auszugehen, dass keine den rechtlichen Anforderungen an eine methodengerechte Ermittlung der Lärmbelastungen genügende Prognose des zu erwartenden Schienenaufkommens angestellt wurde. Das „vorgesehene Betriebsprogramm der BVG“ ist mutmaßlich ein Betriebszustand, der unmittelbar nach Inbetriebnahme vorgesehen ist und sich in den Folgejahren aufgrund der bei Gewöhnung an diese Strecke eintretenden Steigerung des Verkehrsaufkommens noch steigern wird. Diese Steigerung der Anzahl der Zugvorbeifahrten ist aber in der schalltechnischen Berechnung nicht abgebildet. Damit setzt die schalltechnische Berechnung entgegen den Vorgaben der Rechtsprechung nicht auf eine „auf der sicheren Seite“ liegende Ermittlung der Lärmemissionen.
Die nachfolgend geschilderten Grundannahmen hinsichtlich des Zugmaterials für die Linie 12, M 6, die Linie M 8 und die Linie M 10 sind ohne jede Erläuterung und Auseinandersetzung mit den offenbar von der BVG in das Verfahren eingeführten Zahlen einfach dargestellt. Tabelle 1 auf S. 19 lässt sich aber unschwer entnehmen, dass sowohl die Bauart des Zuges, wie auch die Zuglänge sich maßgeblich auf die Lärmbelastung auswirken. Der Autor des schalltechnischen Berichts hätte sich daher – soweit das nicht bereits an anderer Stelle erfolgt ist, was in den hier vorliegenden Unterlagen kaum zu erkennen ist – mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob es sich bei den Angaben der BVG um eine realistische Prognoseannahme für einen plausiblen Prognosehorizont handelt.
Die Einwender gehen davon aus, dass der Autor des schalltechnischen Berichts mit der lärmintensivsten Zugart und einer „auf der sicheren Seite“ liegenden Anzahl von Zügen hätte rechnen müssen und dass diese Berechnung eine erhebliche Mehrbelastung gegenüber der im schalltechnischen Bericht ausgewiesenen Belastung aufgezeigt hätte.
Der schalltechnische Bericht leidet weiter darunter, dass die Einstufung der Gebietskategorien und der ggf. besonders empfindlichen Gebäude zwar in den Anlagen dargestellt, jedoch an keiner Stelle des Berichts abgeleitet ist. Für die Wohnhäuser südlich der Invalidenstraße wird aber ganz überwiegend eher von einer Einordnung in ein Wohngebiet, denn von einer Einordnung in ein Mischgebiet auszugehen sein. Das entspricht in weiten Bereichen des nebeneinander besonders schutzbedürftiger Bebauung, etwa des Seniorenheims oder des Krankenhauses mit Wohnbebauung, daneben aber auch das deutliche Überwiegen der Wohnbebauung in den einzelnen Häusern.
Auf S. 12 setzt sich der Autor mit dem Einfluss der Fahrzeuge auf den Schienenverkehrslärm auseinander und erwähnt, dass sich der Lärmvorteil moderner Niederflur-Fahrzeuge bei der Berechnung nicht auswirken würde. Er setzt aber nicht umgekehrt mit der Frage auseinander, wie sich der Einsatz länger und lauterer Züge in der Prognose auswirken könnte. Die Tatsache, dass der Autor selbst auf S. 9f. des schalltechnischen Berichts aufzeigt, dass es verschiedene Zugarten und verschiedene Zuglängen gibt und in Tabelle 1 auf S. 19 darstellt, dass diese auch erheblich unterschiedliche Lärmauswirkungen haben, hätte eine Auseinandersetzung hiermit aber zwingend erforderlich gemacht.
Auf S. 14 und auch an anderen Stellen seines schalltechnischen Berichts stellt der Autor die These auf, die in der Anlage 2 zur 16. BImSchV vorgegebene Aufrundung mache aus dem 3dB(A)-Kriterium für die Ermittlung der wesentlichen Änderung ein 2,1dB(A) Kriterium. Auf S. 16. bspw. konkretisiert er dies dahin, dass das Kriterium erfüllt sei bei einem Pegelanstieg größer / gleich 2,1 dB(A). In Anlage 2 (ebenso in Anlage 1) zur 16. BImSchV heißt es jedoch lediglich, dass die Beurteilungspegel aufzurunden sind. Die Aufrundung ist nicht davon abhängig gemacht, dass bereits die erste Stelle hinter dem Komma größer als 0 ist. Demnach entspricht auch etwa ein Wert von 2,08 oder 2,09 bei einer Aufrundung einem Wert von 3. Die Abgrenzung „größer / gleich 2,1“ findet sich in der Anlage 2 zur 16. BImSchV nicht.
Die tabellarischen Darstellungen im schalltechnischen Bericht, insbesondere Tabelle 3, zeigen, dass zumindest die Grenzwerte für Mischgebiete, zum Großteil auch die Grenzwerte für Wohngebiete bei aktiven Schutzmaßnahmen wie dem Vorsehen eines Rasengleises einzuhalten wären. Dies gilt insbesondere für die vom Unterzeichneten im Verfahren vertretenen Hauseigentümer, in deren Häusern zumindest weitestgehend die Grenzwerte einzuhalten wären. Für das Haus Invalidenstraße 115 ist das auf S. 25 unschwer erkennbar, für die Häuser Invalidenstraße 122-124 auf S. 26. Für das Haus Invalidenstraße 90 ist das in Tabelle 4 (auf S. 44) zu erkennen, für das Haus Invalidenstraße 101 auf S. 46, für das Haus Invalidenstraße 104 auf. S. 47. Für das Haus Invalidenstraße 120, 121 ist nach den Berechnungsergebnissen auf S. 26 (Tabelle 3) aufgrund der mit der besonders schutzwürdigen Nutzung einhergehenden niedrigen Grenzwerte eine Grenzwerteinhaltung nachts kaum möglich. Jedoch könnten die Grenzwerte tags weitgehend eingehalten werden, was angesichts der weitgehend gleichmäßigen Tag- und Nachtnutzung der Seniorenappartements von großer Bedeutung ist. Zudem kann man sich den Nachtgrenzwerten zumindest einigermaßen annähern.
Der schalltechnische Bericht leidet aus den angeführten Gründen unter durchgreifenden Mängeln und muss insbesondere in Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten einer stärkeren Trennung zwischen Emissions- und Immissionsort, noch vielmehr aber unter Berücksichtigung der Möglichkeiten aktiver Schutzmaßnahmen wie insbesondere des Einbaus des Rasengleises überarbeitet werden.