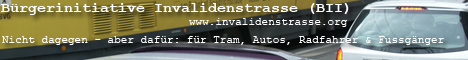Unklar bleibt bei der Lektüre des schwingungstechnischen Berichtes, auf welche Prognosen sich der Bericht hinsichtlich der Zugzahlen, Zuglängen und sonstiger erforderlicher Rahmendaten für die Zugbelegung der Straßenbahngleise stützt. Hinsichtlich der Kritik an dem Fehlen einer Prognose wird insoweit auf die Ausführungen zur schalltechnischen Untersuchung verwiesen. Im Übrigen enthält der schwingungstechnische Bericht zwar einen allgemeinen Bezug auf die schalltechnische Untersuchung (S. 4), aber keinen klaren Bezug auf bestimmte Daten hinsichtlich der Zugbelegung, der Zugarten und Zuglängen etc.. Auch bei den Ausführungen etwa auf S. 14 bleibt offen, mit welchen Zugarten, also welchem Zugmaterial, vom Gutachter gerechnet wurde, obgleich der Gutachter selbst einräumt, dass moderneres Zugmaterial mit Primärfederung ein deutlich besseres Schwingungsverhalten aufweist und damit zu deutlich geringeren Belastungen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern führt. Der Gutachter hätte daher, wie es bei schalltechnischen Untersuchungen Standard ist, Einzelheiten zu den den Berechnungen zugrunde gelegten Zügen und Zugzahlen offen legen müssen. Der reine Verweis auf ein „vorgesehenes Betriebsprogramm“ für die Straßenbahnlinien 12 und die Metrolinien M6, M8, M10, das ihm am 22.03.2007 von Seiten der BVG übergeben worden sei, genügt nicht den Anforderungen an eine Darlegung in Fachgutachten im Planfeststellungsverfahren. So ist letztlich in diesem Punkt nicht nachvollziehbar, wie der Gutachter zu der Aussage kommt, dass er hier „auf der sicheren Seite“ rechnen würde, also eher zu Gunsten der Betroffenen, denn zu deren Lasten.
Nichts anderes gilt letztlich für die anderen Eingangsdaten der Berechnungen. Der Gutachter bezieht sich hinsichtlich der Ermittlungsgrundlagen auf „vorliegende Emissionsspektren“ und standardisierte Übertragungsfunktionen und Rechenverfahren gemäß einem Leitfaden der Deutschen Bahn AG. Er führt aber an keiner Stelle seiner Untersuchung aus, inwieweit die von ihm angeführten und auszugsweise auch in den Anlagen dargestellten Emissionsspektren repräsentativ und hinreichend methodisch abgesichert sind. Zwar stellt er pauschal (vgl. S. 5) die Behauptung auf: „Durch Auswertung von Höchstwerten liegen die Ergebnisse auf der sicheren Seite.“ Doch findet sich für diese Behauptung keine nachvollziehbare methodenkorrekte Ableitung.
Unsere Behauptung sei hier noch einmal an Hand einiger Einzelheiten verdeutlicht:
Der Gutachter wendet „vorliegende Emissionsspektren“ an, die er später in seinem schwingungstechnischen Bericht dahin konkretisiert, dass es sich um selbst gewonnene Messergebnisse an Berliner Straßenbahnstrecken handele. An keiner Stelle seines Berichts führt er aus, dass diese Messungen allgemein akzeptiert oder sonst irgendwie statistisch abgesichert wären. Die Messergebnisse eines einzelnen Sachverständigen stellen aber nicht allein auf Grund der Tatsache, dass ein Sachverständiger diese Messergebnisse erzielt hat, bereits einen anerkannten Stand der Technik dar, der die Abwägung in Planfeststellungsunterlagen bestimmen kann. Üblicherweise werden Werte, die Planfeststellungsverfahren zugrunde gelegt werden, methodisch abgeleitet. Dazu sind Angaben zu deren Herkunft ebenso wie zu ihrer Validität und Zuverlässigkeit und ihrem Verhältnis zu anderen möglichen Bewertungsansätzen erforderlich. In dem gesamten schwingungstechnischen Bericht findet sich dazu keine Angabe. Der Gutachter nimmt wie selbstverständlich einige – dem ersten Anschein nach eher zufällig ausgewählte – Messergebnisse und stützt sein Gutachten maßgeblich auf diese. Das Gutachten kann aus Laiensicht damit ebenso gut ein völliges Zufallsergebnis wie möglicherweise auch ein auf der sicheren Seite rechnendes Sachverständigen-Gutachten sein.
Die vom Gutachter verwendeten standardisierten Übertragungsfunktionen und Rechenverfahren nach dem Leitfaden der Deutschen Bahn AG leiden unter einer ganzen Reihe von Defiziten. Zunächst handelt es sich um Übertragungsfunktionen und Rechenverfahren eines privatrechtlichen Unternehmens, welches ein Interesse daran hat, Schwingungsimmissionen eher niedrig zu rechnen, um nicht überzogenen Schutzansprüchen ausgesetzt zu sein. Die Ergebnisse von hausinternen Überlegungen bei der Deutschen Bahn AG können daher keinesfalls vergleichbar den Ergebnissen der Beratungen zu DIN 4150, Teil 2, als allgemein anerkannte sachverständige Äußerung gesehen werden. Sie sind vielmehr eine Meinung unter möglicherweise mehreren anderen. Der Gutachter hätte diese anderen benennen und darlegen müssen, warum er die Angaben aus dem Leitfaden der Deutschen Bahn AG anderen möglichen Ansätzen vorzieht. Indem er dies nicht tut, fehlt seinem Gutachten jede methodische Grundlage insoweit.
Hinzu kommt, dass die standardisierten Übertragungsfunktionen und Rechenverfahren nach dem Leitfaden der Deutschen Bahn AG für Schienen-Nah- und Fernverkehr, nicht aber für Straßenbahnverkehr entwickelt wurden. Dies erscheint zumindest auf Grund der Quellenangabe naheliegend. Es findet sich aber in dem schwingungstechnischen Bericht gar keine Auseinandersetzung damit, ob und ggf. unter welchen Einschränkungen diese standardisierten Übertragungsfunktionen und Rechenverfahren gleichermaßen auch bei der Straßenbahn anwendbar sein sollen. Der Gutachter verweist hier weder auf irgendwelche eigenen Erkenntnisse noch auf die Erkenntnisse von irgendjemand anderem, noch auf die gängige Praxis in anderen Verfahren, noch gar auf gesicherte Erkenntnisse oder einen allgemeinen Stand der Technik.
Das Gutachten ist daher methodisch bereits in seinen grundlegenden Ansätzen nicht nachvollziehbar.
Gleiches gilt dann für viele Einzelheiten des Gutachtens. So führt der Gutachter zwar auf S. 5 aus, er hätte den sogenannten Schienenbonus bei der Bewertung in seinem schwingungstechnischen Bericht nicht berücksichtigt. Die naheliegende Erklärung dafür, dass nämlich der Schienenbonus für die Bewertung von Körperschallimmissionen nicht wissenschaftlich abgesichert ist, liefert er allerdings nicht. Umso seltsamer mutet es dann an, wenn er auf S. 18 seines schwingungstechnischen Berichts ohne jede Ableitung oder Begründung davon ausgeht, dass zwar der Schienenbonus nicht anwendbar sei, dennoch bei Kommunikations- und Arbeitsräumen eine sogenannte „Überschreitungstoleranz“ von 5 dB entsprechend dem Schienenbonus gewährt werden könne.
Nicht nachvollziehbar und auch methodisch nicht abgeleitet ist die vom Gutachter auf S. 5 (vgl. auch S. 19) gewählte Bewertung „in Analogie zu den Regelungen der Verkehrslärmschutzverordnung“. Denn die Verkehrslärmschutzverordnung stellt auf den Primärschall ab und gibt ausdrücklich nur eine Grundlage für dessen Bewertung. Warum dann auf den sekundären Körperschall und auf die Erschütterungsbewertung die Verkehrslärmschutzverordnung „in Analogie“ angewandt werden sollte, erschließt sich nicht ohne weiteres.
Letzteres gilt umso mehr, als der Sachverständige bei der Bewertung des Körperschalls mit Maximalpegeln arbeitet. Das Differenzkriterium der Verkehrslärmschutzverordnung, welches entgegen der Darstellung des Sachverständigen > 2 dB(A) in der Differenz beträgt und nicht „mindestens 2,1 dB(A)“, ist für die Bewertung von Beurteilungspegeln, also äquivalenten Dauerschallpegeln, entwickelt worden. Dies nun ohne jede Begründung auf eine Bewertung mit Hilfe von Maximalpegeln zu übertragen, erscheint zunächst einmal nicht nachvollziehbar.
Auf S. 9 seines Berichts stellt der Sachverständige die Behauptung in den Raum, dass NBS/offen und das ATD/offen seien im Schwingungs-Emissionsverhalten praktisch gleich. Auch diese Behauptung ist ohne jede Quellenangabe oder Ableitung in den Raum gestellt. Der Gutachter rechnet dann auf Grund der Annahme der Gleichheit im Schwingungs-Emissionsverhalten zukünftig mit den Werten für das NBS/offen. Wären NBS/offen und ATD/offen im Schwingungs-Emissionsverhalten tatsächlich praktisch gleich, hätte es dieser Bemerkung nicht bedurft. Der Gutachter könnte dann mit gleichen Werten rechnen, ohne dass es eine Differenz geben würde. Die Bemerkung des Gutachters lässt darauf schließen, dass es Differenzen gibt. Diese Differenzen hätte der Gutachter aber darlegen müssen. Indem er die Differenzen nicht darlegt, erlaubt er dem geneigten Leser nicht, seine Behauptung auch methodisch nachzuvollziehen.
Ebenso wenig nachvollziehbar ist die Behauptung des Sachverständigen, die NBS/offen sei nach Messungen des Verfassers herkömmlichen Aufbauten von Straßenbahnanlagen überlegen. Der Sachverständige stellt diese Behauptung in den Raum, ohne hierfür Quellen anzugeben und Messergebnisse vorzulegen, die dies allgemein nachvollziehbar machen. Er hätte hier darstellen müssen, welche Messungen insgesamt in diesem Bereich angestellt wurden, wie seine Messungen im Verhältnis zu eventuellen anderen Messungen stehen und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Der reine Verweis auf Tabelle 1 im Anhang des Berichts reicht insoweit nicht aus. Tabelle 1 scheint einige Messergebnisse widerzugeben, wobei dort das NBS/geschlossen zunächst als das System erscheint, welches die geringsten Belastungen hervorruft, bei näherer Betrachtung jedoch in einzelnen Belastungsbereichen eine höhere Belastung als alle anderen Gleisarten aufweist. Auch das NBS/offen weist in einzelnen Belastungsbereichen höhere Messergebnisse aus, als etwa das Rahmengleis, was wohl mit dem vom Sachverständigen angeführten „herkömmlichen Aufbau“ übereinstimmt. Wie diese Messergebnisse nun im einzelnen zu bewerten sind, ob insbesondere das schlechtere Abschneiden des NBS/offen und des NBS/geschlossen in einzelnen Belastungsbereichen unter welchen weiteren Überlegungen die sichere Schlussfolgerung erlaubt, das NBS/offen sei als Gleiskonfiguration mit den geringsten Belastungen in der Invalidenstraße den anderen Gleisoberbauarten vorzuziehen, ist nirgendwo im Gutachten abgeleitet. Schon gar nicht findet sich in dem Gutachten ein Hinweis darauf, inwieweit die Messungen des Verfassers von unabhängigen Stellen überprüft und allgemein anerkannt wurden.
Auch bei anderen Angaben fehlen methodische Ableitung und/oder Quellenangabe, um diese als glaubhafte und methodenkorrekte Darstellung des Sachverständigen erscheinen zu lassen,
- etwa bei der Angabe der Fühlschwelle von 0,1 mm/s (S. 12);
- etwa bei der Angabe, dass die Maximalpegel beim Schienenverkehr immer > 10 dB(A) über den Beurteilungspegeln liegen würden (vgl. S. 17).
Auf die letztgenannte nicht mit Quellen oder einer methodischen Ableitung belegte Behauptung stützt der Sachverständige sein weiteres methodisches Vorgehen, nur den A bewerteten mittleren Maximalpegel zur Bewertung heranzuziehen.
Den Begriff der „einzelnen kurzzeitigen Geräuschspitzen“ interpretiert der Sachverständige – ohne auch nur seine Herkunft zu benennen – kurzer Hand als mittlerer Körperschall-Maximalpegel LAmax während der Zugvorbeifahrten. Methodenkorrekt hätte der Sachverständige sowohl die Herkunft der von ihm benannten Formulierung (einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen) benennen als auch die Interpretation methodenkorrekt ableiten müssen. Beides ist nicht geschehen. Seine Darstellung ist nicht nachvollziehbar.
Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist die Abgrenzung des Untersuchungsbereichs. Der Sachverständige behauptet auf S. 19, alle Gebäude im Einwirkungsbereich untersucht zu haben, bei denen ein Erreichen oder Überschreiten der Anhaltswerte nicht von vornherein ausgeschlossen werden konnte. Wie erfolgte der Ausschluss? Wie wurde sichergestellt, dass man auch beim Ausschluss zu Gunsten der Betroffenen auf der sicheren Seite liegt? Der Sachverständige wirft mit seiner Behauptung eine Vielzahl von Fragen auf, beantwortet aber keine, sondern stellt lediglich eine Behauptung in den Raum. Ist der Ausschluss durch eine räumliche Abgrenzung in einem bestimmten Abstand von der jeweils äußeren Gleisachse erfolgt? Oder erfolgte der Ausschluss nach anderen Kriterien?
Offen bleibt die Frage, warum der Sachverständige bebaubare Grundstücke, also hier insbesondere die Baulücken entlang der Invalidenstraße zwischen der Bestandsbebauung, nicht in seine Betrachtungen mit einbezogen hat. Für diese Grundstücke besteht Baurecht, das bereits vom Eigentumsgrundrecht erfasst ist. Aus § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung, der der Sachverständige an anderer Stelle „in Analogie“ heranzieht, ergibt sich eindeutig, dass der Schutz gebietsbezogen erfolgt. Das gilt insbesondere für die hier in Betracht kommenden allgemeinen Wohngebiete und Mischgebiete. Noch deutlicher wird der Schutzgedanke des Immissionsschutzrechtes in § 41 Abs. 1 Satz 2 BImSchG. Danach sind Entschädigungsansprüche – selbstverständlich wie man annehmen könnte – in gleichem Maße für bauliche Anlagen geltend zu machen, die bei Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder bei Auslegung des Entwurfs der Bauleitpläne mit ausgewiesener Wegeplanung bauaufsichtlich genehmigt waren. Im vorliegenden Falle gilt das zumindest für die Häuser Invalidenstraße 116/117 (Wohnhäuser) und 118/119 (Bürohäuser), die seit Jahren genehmigt sind und deren Baugenehmigung bis heute gilt. Wenn der Sachverständige einen Bewertungsansatz „in Analogie“ zur Verkehrslärmschutzverordnung wählt, so muss er auch insoweit die immissionsschutzrechtlichen Grundsätze gelten lassen und die Baulücken in seine Prüfung mit einbeziehen, wobei für die Bemessung von aktiven Schutzmaßnahmen, also Schutzmaßnahmen am Verkehrsweg selbst, auf die Bebaubarkeit, für die Bemessung passiver Schutzmaßnahmen an den Gebäuden auf den Bestand der Baugenehmigung abzustellen wäre.
Auf S. 20 f. des Berichts wird dann u.a. ausgeführt, dass die Immission sich aus den Emissionsspektren von Straßenbahn und der Abstands- und Materialdämpfung im Boden und den Übertragungsfunktionen ergebe. Als Emissionsfaktoren wird auf die eigenen Messergebnisse, Tabelle 1 in der Anlage, verwiesen. Zu der Frage, wie die Spektren aus Tabelle 1 in der Anlage zu sonst gemessenen Spektren stehen und welche sonst gemessenen Spektren es noch gibt, welche Bewertung sich also neben der selbstgewählten noch anbieten würde, nimmt der Sachverständige auch hier nicht Stellung.
Die Übertragungsfunktion für Holz-/Betondecken soll dem Leitfaden der Deutschen Bahn AG entnommen sein. Auch hier steht nichts dazu, inwieweit diese Werte „auf der sicheren Seite“ liegen, inwieweit sie überhaupt übertragbar sind auf den Straßenbahnverkehr und hier zu zutreffenden Ergebnissen, die methodisch „auf der sicheren Seite“ liegen, führen können. Der Leitfaden der Deutschen Bahn AG ist eine Meinungsäußerung eines an der Erzielung nicht zu hoher Berechnungsergebnisse bei Erschütterungs- und Körperschallbelastungen interessierten Unternehmens und nicht ohne weiteres auf jedes Planfeststellungsverfahren für Straßenbahnen übertragbar.
Das zuvor Genannte trägt in gleicher Weise bei den Überlegungen zu Abstands- und Materialdämpfung, die ebenfalls nach dem Leitfaden der Deutschen Bahn AG vorgenommen wurden.
Nicht nachvollziehbar sind auch die für die Berechnung maßgeblichen Bezugspunkte an den Gebäuden. Sie sind in Bild 1 (Bl. 54) lediglich beispielhaft für den westlichen Kreuzungsbereich Invalidenstraße/Chausseestraße dargestellt. Wo sie bei den anderen Gebäuden liegen, ist dem Gutachten nicht zu entnehmen.
Auf S. 24, 25 des Berichts wird deutlich, dass sich die bereits oben kritisierte methodisch nicht nachvollziehbare Bewertung eines Toleranzbereiches für die Überschreitung der Anhaltswerte beim Körperschall von 5 dB für Kommunikations- und Arbeitsräume auch auf das Ergebnis auswirkt, indem die Mehrzahl der Überschreitungen der Anhaltswerte nach der Wertung des Gutachters dann doch zu keinen Ansprüchen führen sollen, da sie sich auf Kommunikations- und Arbeitsräume beziehen würden und die „Toleranz“ von 5 dB nicht überschreiten würden.
Zur Körperschallprognose an der Umbaustrecke (Invalidenstraße östlich der Chausseestraße) ist auf S. 26 ausgeführt, es käme zu einem Rückgang der Körperschallbelastungen durch den Ersatz alter Gleise durch das „neue Berliner Straßenbahngleis“. Wie schon an anderer Stelle kritisiert, bleibt der Gutachter die methodische Ableitung bzw. den Nachweis wie auch die Anerkennung seines Nachweises insofern schuldig. Für den interessierten Laien, der diese Planfeststellungsunterlagen für sich und seine Betroffenheit auszuwerten hat, sind die Darlegungen des Gutachters nicht mehr nachvollziehbar.
Nicht ausreichend sind die Ausführungen des Gutachters auf S. 27 für die Ableitung der Schutzmaßnahmen. Ist der Gutachter zunächst auch der Auffassung, dass um 9 dB(A) überschrittene Anhaltswerte zu entsprechenden Schutzmaßnahmen führen müssten, führt er danach aus, dass sich aber in den Erdgeschossen der beiden betroffenen Häuser in der Invalidenstraße 98 und 100 keine Schlafräume befinden würden, die Schutzansprüche daher für das erste OG greifen würden und hier um 3 dB(A) verminderte Anforderungen gelten würden. Diese Verminderung der Anforderungen um 3 dB begründet der Gutachter aber weder mit einem Hinweis auf irgendwelche Quellen, aus denen sich so etwas ergeben würde, noch mit dem Hinweis auf eigene Erkenntnisse oder einen allgemeinen Stand der Technik insoweit. Hier fehlt also die Ableitung.
Dies ist umso bedeutender, als diese Annahme einer Verminderung um 3 dB den Gutachter zu der Aussage veranlasst, es müsse lediglich der Wert um 6 dB gesenkt werden und diese 6 dB könnten durch den Einbau eines leichten Masse-Federsystems oder durch kontinuierliche elastische Schienenlagerung erreicht werden. Offenbar sind danach beide Maßnahmen nicht geeignet, die Minderung um 9 dB(A) zu bringen, die nach der Auffassung des Gutachters für das Erdgeschoss zu erwägen wären. Das ist aber umso bedenklicher, als die Tabellen im Anhang zum Bericht gar nicht auf einzelne Stockwerke bezogen sind, sich diesen Tabellen also gar nicht entnehmen lässt, wo die höchste Belastung tatsächlich auftritt und ob diese höchste Belastung durch Körperschall tatsächlich im Erdgeschoss auftritt. Den Ausführungen des Sachverständigen ist nicht zu entnehmen, dass die höchste Belastung stets im Erdgeschoss auftritt. Demzufolge ist es auch nicht ohne weiteres selbstverständlich, dass für das Abstellen auf das erste Obergeschoss um 3 dB verminderte Werte anzusetzen wären. Was wäre, wenn ausgerechnet das 1. OG oder das 2. OG die höchstbelasteten Geschosse wären?
Auch die angebliche Dämmwirkung von 6 dB eines leichten Masse-Federsystems oder einer kontinuierlichen elastischen Schienenlagerung ist vom Gutachter weder mit Quelle noch mit irgendwie gearteter Ableitung belegt. Der Gutachter lässt sich auch nicht darüber aus, welche Erfahrungen hier vorliegen, wie dauerhaft eine solche Minderung sichergestellt ist, welche Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen dafür erforderlich sind etc.. Auch die Höhe der zu erzielenden Minderung und die Frage, ob diese abhängig ist von weiteren Gegebenheiten in der Umgebung, ist den Ausführungen des Gutachters nicht zu entnehmen. Vor allem aber ist den Gutachterausführungen nichts dazu zu entnehmen, was die Vor- und Nachteile der beiden vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen eigentlich sind, ob diese insbesondere auch unterschiedliche Dämmwirkungen haben, also unterschiedliche Schutzwirkung zu Gunsten der Betroffenen entfalten.
Der Gutachter führt aber selbst aus, beide System würden spezifische Vorteile und Nachteile aufweisen und seien für die Invalidenstraße grundsätzlich geeignet. Er meint, die Auswahl solle dem Vorhabensträger im Rahmen der Ausführungsplanung überlassen werden.
Damit befindet sich der Gutachter aber offensichtlich im Irrtum hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen, die hier zu erfüllen sind. Der Gutachter untersucht, ob Schutzauflagen zum Schutz vor nicht mehr zumutbaren Immissionen geboten sind und kommt zu dem Ergebnis, dass dies der Fall sei. Wenn dem so ist, dann hat aber die Planfeststellungsbehörde durch eigene Abwägung darüber zu entscheiden, welche Schutzmaßnahmen unter welchen genauen Bedingungen zu ergreifen sind. Sie hat sich insbesondere der Eignung, der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen zu widmen. Dazu muss sie sich mit den spezifischen Vorteilen und Nachteilen, der Geeignetheit als Schutzmaßnahme (also auch Differenzen bei der Dämmwirkung) ebenso auseinandersetzen wie mit Kostenfragen, die bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit eine zentrale Rolle spielen. Das Gutachten müsste die Planfeststellungsbehörde dazu in die Lage versetzen und zuvor die Betroffenen in die Lage versetzen, dazu Stellung zu nehmen, welche Schutzmaßnahmen sie für angemessen halten.
Darüber hinaus muss sich das Gutachten auch deswegen mit den Vor- und Nachteilen der von ihm vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen auseinandersetzen, weil es sich offenbar um Gleisbauarten handelt, die erst seit einigen Jahren in Berlin erprobt werden. Insbesondere die Messergebnisse in der Tabelle 1 sind hinsichtlich des NBS/offen jüngeren Datums (2005, 2007) und scheinen darauf hinzudeuten, dass es sich um eine Gleisoberbauart handelt, die erst seit einigen Jahren erprobt wird. Der Gutachter hätte daher auch auf die Frage eingehen müssen, ob die dauerhafte Dämmwirkung sichergestellt ist und welche Pflegemaßnahmen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen hierfür erforderlich sind. Denn derlei regelmäßige Pflege- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sind von der Planfeststellungsbehörde verbindlich festzulegen, wenn sie erforderlich sind, um die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten. Dies ist – worauf hier als Beispiel verwiesen werden soll – etwa beim besonders überwachten Gleis allgemein anerkannt. Hier werden Überwachungs- und Schleifzyklen festgelegt, um die dauerhafte Schutzwirkung sicherzustellen.
Nichts anderes muss aber auch für Schutzmaßnahmen gegen sekundären Körperschall gelten. Das liegt auch in der Konsequenz der Ausführungen des Sachverständigen, der ja selbst Wertungen „in Analogie zur Verkehrslärmschutzverordnung“ vornimmt.
Die Planfeststellungsbehörde muss sich – wie das Bundesverwaltungsgericht etwa in seiner Entscheidung zur S-Bahn S3 am S-Bahnhof Charlottenburg klargestellt hat – darüber hinaus damit auseinandersetzen, für wen die Schutzmaßnahmen im einzelnen Schutzwirkung entfalten sollen. Denn ihre Abwägung ist nicht darauf beschränkt, absolut unzumutbare Belastungen zu bewältigen. Auch unterhalb der Unterschreitung der Zumutbarkeitsgrenze kann die Planfeststellungsbehörde Schutzauflagen festlegen. Im Rahmen ihrer Abwägung hat sie ihr Augenmerk zwar vorrangig auf die Vermeidung unzumutbarer Belastungen auszurichten. Daneben muss sie aber auch die weiteren Schutzwirkungen ihrer Maßnahmen in den Blick nehmen.
So wäre im vorliegenden Fall etwa zu prüfen, ob und inwieweit die Gebäude Invalidenstraße 101 und 102 durch die Maßnahmen mitgeschützt sind.
Auch müsste die Planfeststellungsbehörde in die Lage versetzt werden, zu überprüfen, ob die vom Sachverständigen als wirksame Schutzmaßnahme bezeichnete elastische Matte, die nach seinen Angaben im Kreuzungsbereich Invalidenstraße/Chausseestraße eingebaut werden soll, nicht zweckmäßiger Weise weitergezogen werden sollte in Richtung Westen bis jenseits der Hessischen Straße, um ausreichenden Schutz durchgängig von der Chausseestraße bis zur Hessischen Straße sicherzustellen.
Schließlich müsste die Planfeststellungsbehörde sich mit der Frage auseinandersetzen, ob angesichts der extrem hohen Grenzwertüberschreitungen bei Lärm und Schadstoffen auch in der Invalidenstraße östlich der Chausseestraße ein Ausgleich durch Einbau elastischer Matten oder anderer immissionsmindernder Maßnahmen geboten bzw. abwägungsgerecht ist.
Von Seiten der Einwender wird jedenfalls gefordert, dass effektive Schutzmaßnahmen bei dem hier vorliegenden faktischen Neubau der Straßenbahn auf gesamter Länge von Anbeginn an ergriffen werden, so dass in dem Umbaubereich eine deutliche und langfristig gesicherte Verbesserung der Situation eintritt und in dem Neubaubereich effektive Schutzmaßnahmen sicherstellen, dass weder unzumutbare noch nahe der Unzumutbarkeitsschwelle liegende Belastungen auftreten.
Die Einwender fordern eine schwingungstechnische Untersuchung, in der die Methodik insgesamt und jede einzelne Annahme nachvollziehbar und methodengerecht dargestellt werden und eine Belastungsberechnung und deren Darstellung erfolgt, die erkennen lässt, welche einzelnen Bezugspunkte an jedem einzelnen Gebäude gewählt wurden und mit welchen Belastungen für welche einzelnen Stockwerke eines Gebäudes zu rechnen ist. Es wird ein in sich stimmiges, abgeschlossenes und dauerhaft gesichertes Schutzkonzept gefordert, das vorzugsweise bei einer Straßenbahn mit eigenem Gleiskörper und dem Einbau der Gleise in Rasen umgesetzt werden sollte.